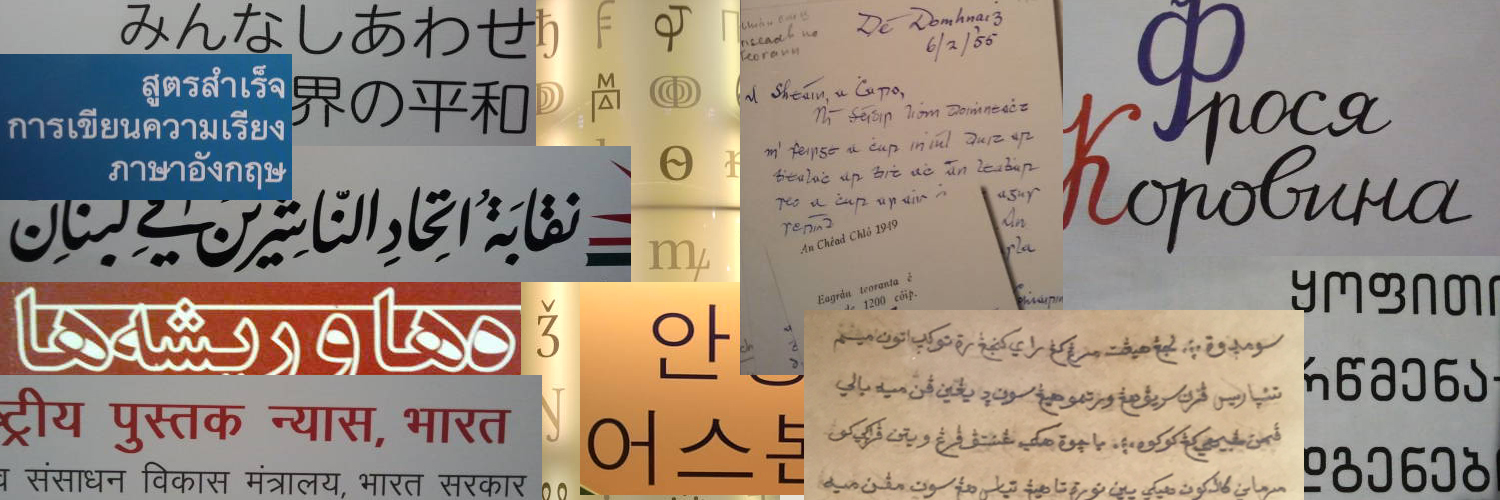Neulich erzählte eine Freundin, dass ein Kollege immer davon spreche, irgendwelche Daten „verwursten“ zu wollen – „verarbeiten“ ist wohl zu alltäglich. (Wobei in Wurst ja vieles verarbeitet ist, aber das ist kein Sprachthema.) Das setzte eine Kaskade von Assoziationen in Gang, von denen keine mit dem Lebensmittel an sich zu tun hat – außer einer, aber davon später.
Worin die Wurst steckt
Zum Beispiel sagt man, wenn einem etwas egal ist, es sei einem „wurscht“ (oder „wurst“). Warum? Da gibt es offenbar verschiedene Deutungen: von „Herkunft unklar“ über die Erklärung, das komme aus der Studentensprache und beziehe sich auf die Enden der Wurst, die ja beide gleich seien, also sei es unwichtig, wo man anfange, bis hin zu Metzgern, denen es egal war, welche Schlachtabfälle sie, nun ja, verwursteten.
Dazu gehört auch das Vor-sich-hin-Wursteln, beim Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS; [https://www.dwds.de/wb/etymwb/wursteln]) als „unordentlich, ungeschickt drehen, durcheinanderbringen, verwirren“ definiert, bzw. das Sich-Durchwursteln. Nett ist auch die Vorstellung, dass zwei Ringer sich „ungeschickt durcheinanderbringen“, denn auf Niederländisch heißt Ringen „worstelen“, was auch mit dem englischen „wrestling“ verwandt ist.
Damit hat man auch ein schönes Beispiel für eine sogenannte Metathese – das Vertauschen zweier Laute. Und da Wurst nicht nur von Menschen gegessen wird, sondern auch Wespen sich gern daran gütlich tun, erklärt mir das Phänomen der Metathese auch, wieso eine niederösterreichische Bekannte über diese Insekten in vollem Ernst von „Wepsen“ sprach – und ich hatte immer gedacht, dabei handele es sich um ein kleines finno-ugrisches Volk [https://de.wikipedia.org/wiki/Wepsen].
Aber wurscht, hier geht es nicht um die Wurst – in früheren, ärmeren Zeiten bei Wettbewerben auf Volksfesten war das der Preis für den Sieger. Wer verlor, war ein armes Würstchen. Diese Bezeichnung wiederum wird auf die lautliche Ähnlichkeit zu einem armen Würmchen zurückgeführt, das an einem Angelhaken aufgespießt wird. Und wer sich zum Narren machte, war ein Hanswurst („Seit dem 16. Jh. als spöttische Bezeichnung dicker Leute bezeugt“; [Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter, 198922, S. 293.] Details bitte selber nachlesen, das würde jetzt zu weit führen.
Dazu ein bisschen Käse
Vielleicht denkt ihr jetzt auch: „Das ist doch alles Käse!“ Also Unsinn oder Quatsch (was wiederum stark an Quark erinnert, und das wird auch in dieser Bedeutung verwendet). Das kommt wohl daher, dass Quark bzw. Käse in früheren Zeiten (lang ist’s her) ein billiges Nahrungsmittel war, das man auf diese Weise verunglimpfen konnte. Und eine Zeitung, in der lauter Blödsinn steht, ist eben ein Käseblatt.
Auch menschliche Körperteile können mit Käse in Verbindung gebracht werden. Entweder optisch: jemand ist käsig oder käseweiß im Gesicht, oder olfaktorisch, was sich dann auf die untersten Extremitäten (die mit den idealerweise zehn Zehen) bezieht.
Jetzt wird’s poetisch
Zum Abschluss aber der schönste Bezug zur Wurst, den ich kenne:
„O hätte ich ein Wurstebrot
mit ganz viel Wurst
und wenig Brot!“
[Josef Guggenmos, Was denkt die Maus am Donnerstag? München: dtv, 1971, 199219 (1967 Georg Bitter Verlag), S. 106.]
Ein Wunsch, den ich als Kind so gut nachvollziehen konnte!