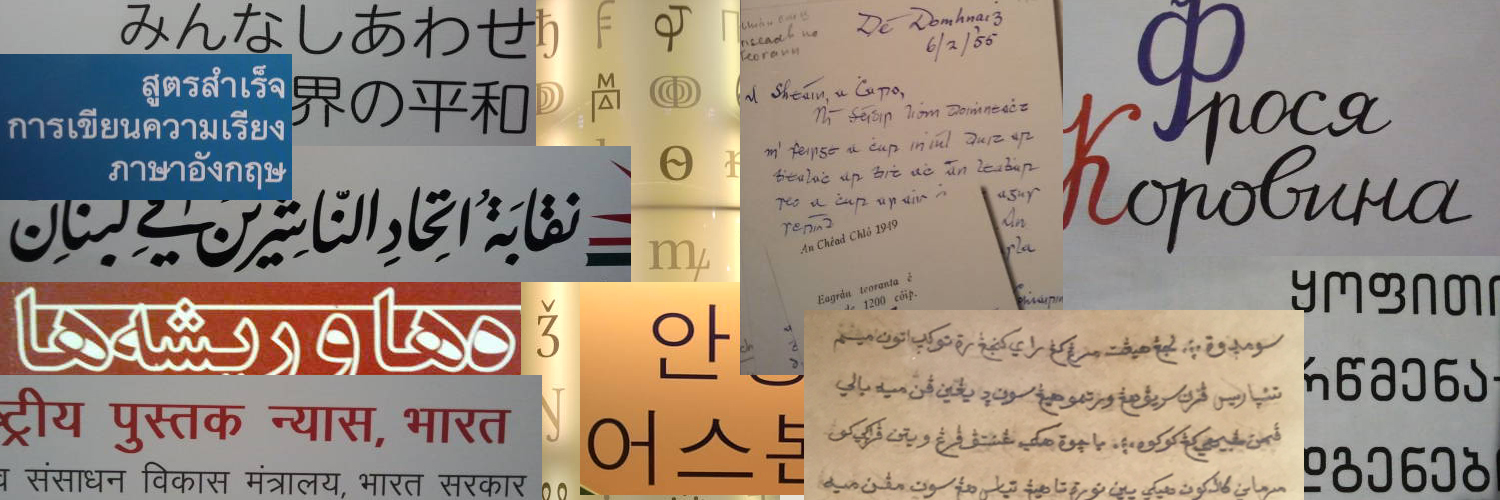„Ein Mord in Duisburg – das war bestimmt wieder ein Mafiosi!“ sagte der Mann in der S-Bahn zu seinem Nachbarn.
Ähm – nein, wenn überhaupt, war es ein Mafioso. Mafiosi treten in der Regel in mehrfacher Ausfertigung auf, vielleicht liegt es daran, dass das leicht verwechselt wird – man kann schließlich nicht erwarten, dass sich jede/r mit der Aussprache nicht-deutscher Wörter beschäftigt. Von Journalisten schon, aber die Mehrzahl der Bevölkerung ist das nun mal nicht.
Es hat aber überhaupt seine Tücken, den italienischen Plural ins Deutsche zu übertragen. Nehmen wir zum Beispiel die Zucchini. Abgesehen von der Aussprache („zuckini“, nicht „zuschini“): wie nennt man ein einzelnes Exemplar dieses Gemüses? Der Duden sagt: zucchino („besonders fachsprachlich, selten“, vermutlich weil man meistens „ein Zucchini“ oder „ein Stück“ sagen würde, wobei man ja meistens mehr als eines nimmt. Nun sagen meine italienischen Verwandten aber: Quatsch, das heißt „la zucchina“, also müsste der Plural „le zucchine“ lauten. Das funktioniert im Deutschen aber aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens sagt das italienische Wörterbuch „zucchina s. f. (tosc. zucchino m.)“ – die maskuline Bezeichnung mit der Endung -o stammt also aus der Toskana, wohin viele Deutsche gereist sind und noch reisen. Zweitens würde die Endung -e bei „zucchine“ wie bei „Ente“ ausgesprochen, und das klänge sehr unitalienisch.

Was gibt es noch? Spaghetti – „mir ist ein Spaghetto runtergefallen“ kann man tatsächlich sagen, jedenfalls auf Italienisch.
Und dann gibt es natürlich noch ein verwandtes Problem – die lateinischen Pluralformen. „Diese Manager kriegen immer fette Bonis“ – inhaltlich … nun ja, aber grammatikalisch? „Boni“ ist schon ein Plural, nämlich von „Bonus“ – kennt man ja von „Bonuspunkten“ und so. Das hat das Italienische vom Lateinischen fortgeführt. Aber wie ist das bei dem in der Coronazeit häufig vorkommenden Wort „Virus“? Da heißt es eben nicht „Viri“, sondern „Viren“, hat also eine deutsche Endung bekommen. Noch schwieriger ist es bei „Diskus“ – zugegebenermaßen braucht man außer als Leichtathletik-TrainerIn den Plural eher selten: „Diski“ heißt es nicht, sondern einfach „Diskusse“ oder tatsächlich „Disken“ (hat das wirklich schon mal jemand benutzt?). Und am allerblödesten wäre es bei Bussen: nein, nicht „Bi“, sondern „Busse“, also wieder eine deutsche Endung.

Und zum Schluss noch mal was Italienisches, eine beliebte Frage: heißt es „due espressi“ oder was? Also, wenn man in Italien einen Espresso bestellen will: „due caffè, per favore!“ Allerdings muss man aufpassen, dass man nicht in einer deutschen Touristenhochburg bestellt; dann kann es einem passieren, dass man einen deutschen Filterkaffee serviert bekommt. Und in Deutschland kann man einfach „zwei Espresso“ bestellen.